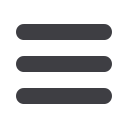
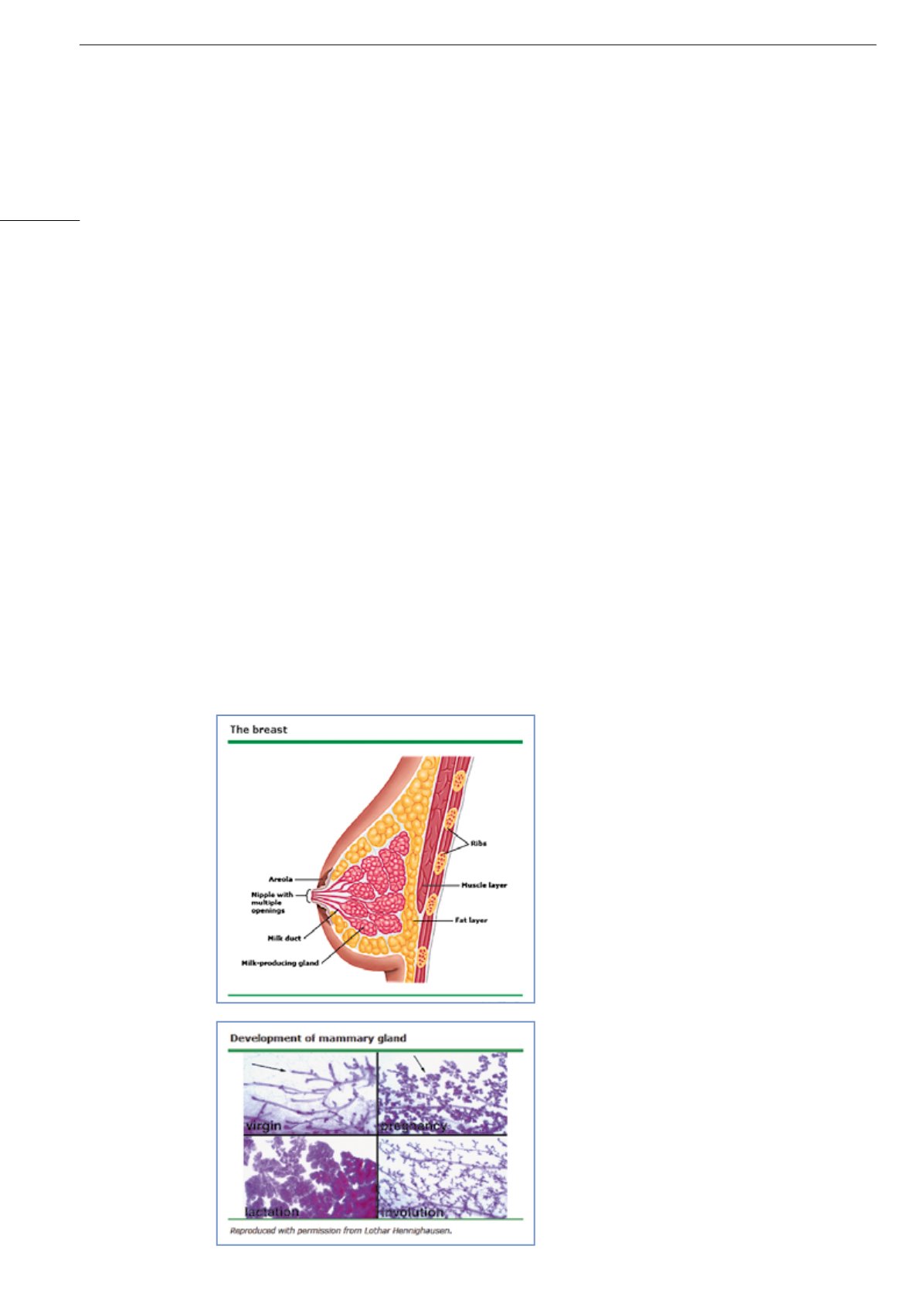
FORTB I LDUNG
01 / 2017
K I N D E R Ä R Z T E
.
SCHWEIZ
30
Muttermilch – mehr als adaptierte Kuhmilch
D
ass Muttermilch die natürliche und auch beste Er-
nährung für jeden Säugling ist, wissen wir spätestens
nach sorgfältigem Studium aller gängigen Reklamen für
Pulvermilch. Doch wie entsteht diese «Muttermilch» und
was zeichnet sie im Vergleich zur Pulvermilch aus? Dazu
möchte ich in diesem Artikel mit Blick auf die faszinieren-
de Herstellung der Muttermilch eingehen.
Die Brustdrüse
Jede Frau und insbesondere jede Mutter hat ein kleines
Wunderwerk der Natur erhalten – ihre Brust. Das Wis-
sen um dieses «Wunderwerk» ist für mich ein beson-
ders wichtiges Argument in der Stillberatung von jun-
gen und älteren Müttern. Die Brust besteht aus einer
Brustdrüse
(Fig. 1),
welche im Verlauf der Schwanger-
schaft von einigen wenigen Zweigen in einen wahren
Drüsenbaum knospen. Dies wird in
Fig. 2
ersichtlich und
zeigt, wie schön sich der Körper auf die bevorstehende
Ernährung des Kindes vorbereitet. Mit der Geburt be-
ginnt die Produktion der eigentlichen Muttermilch, auf
welche ich nun eingehen möchte.
Die 5 Transportmechanismen der Brustdrüse
Wir kennen heute 5 Wege der Sekretion der Brust-
drüsenzellen, welche benötigt werden, um die Mutter-
milch dem Säugling alters- und mahlzeitengerecht
zu präsentieren. Es handelt sich um 1) die Exocytose,
2) die reverse Pinocytose, 3) die Transcytose, 4) den api-
kalen Transport und 5) die Diapedese beziehungsweise
den parazellulären Transport. Mit jedem dieser Mecha-
nismen werden gewisse Ernährungsstoffe, aber auch
zelluläre Elemente ins Lumen der Drüse transportiert,
woraus schliesslich die eigentliche Muttermilch ent-
steht.
Die Exozytose ist der klassische Transportweg für Mo-
leküle, welche in der Zelle synthetisiert werden. Dies
sind vor allem Proteine und Lactose. Sie werden vom
Golgi-Apparat (einem Teil des Endoplasmatischen Re-
tikulums) in Micellen gerichtet an die apikale Zellwand
transportiert. Diese Micellen vereinen sich mit der Zell-
wand, wodurch der Inhalt gegen aussen (d. h. das Lu-
men) ausgeschüttet und somit zu einem Teil der Mut-
termilch werden
(Fig. 3).
Etwas komplizierter ist die reverse Pinocytose. Dabei
schnürt sich die Zellwand apikal ab und in den entste-
henden Vesikeln sammeln sich Zellbestandteile der Drü-
senzelle, wie z. B. Ribosomen oder Mitochondrien, wel-
che so in die Muttermilch und damit den kindlichen
Darm gelangen
(Fig. 4).
Bei der Transzytose werden intakte maternelle Prote
ine – wie z. B. Hormone, Immunglobuline oder Albumin
– direkt per Pinocytose basal in die Drüsenzelle gelotst
und nach Passage apikal mittels Exozytose ins Lumen
abgegeben
(Fig. 5).
Ähnlich gibt es auch einen direkten Porenabhängigen
Prozess, den sogenannten Apikalen Transport. Hierbei
wird vor allem Flüssigkeit, nämlich Wasser transportiert,
was je nach Muttermilch bis zu 90% der eigentlichen
Milch ausmacht. Dieser sehr effektive Transport wird er-
möglicht durch eigentliche Poren im basalen und auch
apikalen Bereich der Zelle. Innert kurzer Zeit kann ein
Mehrfaches des eigentlichen Zellvolumens umgesetzt
werden.
Der letzte und sicher interessanteste Transportmecha-
nismus ist die Diapedese
(Fig. 6).
Dabei können hoch-
molekulare Substanzen oder gar ganze Zellen die sonst
fixe Verbindung zwischen den einzelnen Drüsenzellen
(tight junctions) überwinden und dadurch direkt ins Lu-
men der Drüse gelangen. Dies wird vor allem von müt-
terlichen immunologischen Zellen z. B. Makrophagen,
wahrscheinlich aber auch von anderen Zellen, (z. B.
mütterliche Darmbakterien) genutzt, welche so in die
Muttermilch gelangen.
DR. MED.
RAFFAEL GUGGENHEIM,
VORSTAND KIS
Fig. 1: Der Aufbau
der Brust.
Quelle: Up to date
®
Fig. 2: Entwicklung
der Brustdrüse.
Quelle: Up to date
®
















