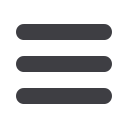
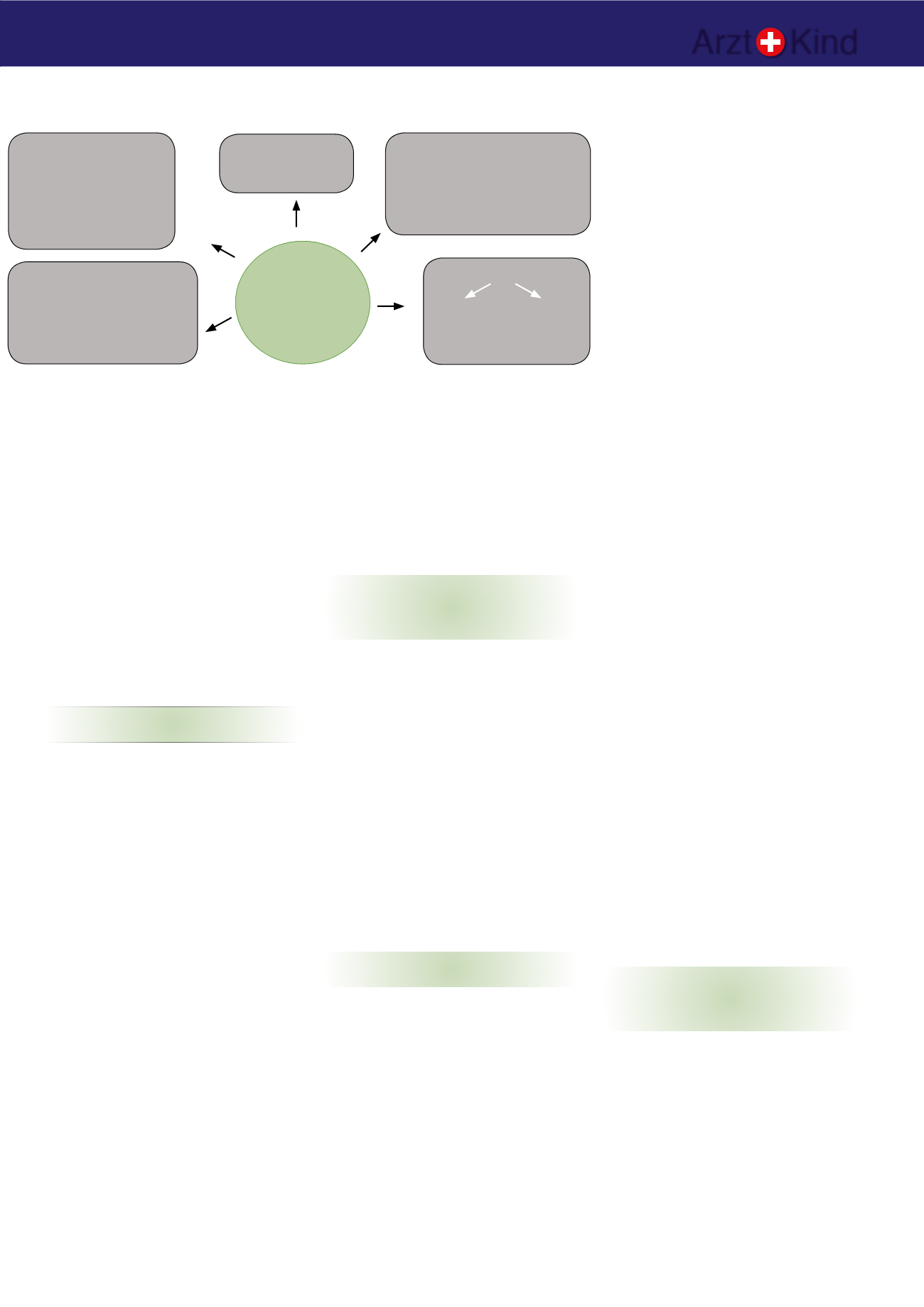
33
Verdauung und
Absorption von Nährsto en
und Flüssigkeiten
- Ernährungszustand
- Flüssigkeitshaushalt
- Normale Stuhlfrequenz
und –konsistenz
Mikrobiota
- hohe Diversität
- günstige Zusammensetzung
- keine bakterielle Überwucherung
- keine Störfaktoren
(Antibiotika, Infektionen)
Darm – Hirn - Achse
- Gute Lebensqualität
- Positive Stimmung
- Ausgeglichene Serotoninproduktion
- Normale Funktion des
enteralen Nervensystems
Abwesenheit von
gastrointestinalen
Erkrankungen
Immunfunktion
- Darmbarriere
- Systemische Immune ekte
Abwehr
Toleranz
Hauptaspekte eines
gesunden
Gastrointestinaltraktes
Abb. : Hauptaspekte der Darmgesundheit
[
5
]
Arzt Kind
im menschlichen Körper, wobei deren kol-
lektive genetische Information 150 x mehr
Gene als das menschliche Genom zählt. [3]
Der Großteil der physiologisch im Darm vor-
kommenden Spezies ist obligat anaerob und
es wird angenommen, dass etwa 99% jener
Keime mit traditionellen Methoden nicht
kultiviert werden können. Erst die Entwick-
lung kultur-unabhängiger Methoden, die auf
Genotypisierung anstelle von traditioneller
Kultivierung und Phenotypisierung beruhen,
ermöglichte es, das volle Ausmaß dieser mik-
robiellen Vielfalt zu erfassen [3]
Zusammensetzung der Mikrobiota
Von den bisher ca. 1.000 unterschiedlichen im
Darm von Menschen nachgewiesenen Spe-
zies, kommen etwa 160 bei jedem einzelnen
von uns vor. [4] Es gibt große Unterschiede
in der individuellen Zusammensetzung der
Darmmikrobiota, wobei eine hohe Diversi-
tät als günstig für den Wirt angesehen wird.
Jede Mikrobiota ist einzigartig und stellt eine
„Signatur“ dar, ähnlich einem Fingerabdruck.
Die Hauptcharakteristika dieser individuellen
Mikrobiota festigen sich schon früh im Leben
eines Menschen. Nach starken Schwankun-
gen in den ersten Lebensjahren entwickelt
sich etwa ab dem 2. Lebensjahr eine über
unser Leben weitgehend stabile Mikrobiota.
Diese wird von 4 Stämmen dominiert, den
grampositiven Firmicutes und Actinobacte-
ria sowie den gramnegativen Proteobacteria
und Bacteroidetes. [5]
Dabei variiert deren Dichte und Zusammen-
setzung in den einzelnen Abschnitten des
Gastrointestinaltraktes – beein usst durch
pH-Wert, gastrointestinale Sekrete (Säure,
Enzyme, Schleim), Nahrung und gastrointes-
tinaler Motilität – erheblich. Vom Magen bis
rend der Schwangerschaft Stressoren ausge-
setzt waren, signi kant niedrigere Konzentra-
tionen an Bi dobakterien und Laktobazillen
im Stuhl. [8] Auch die perinatale Gabe von
Antibiotika führt zu einer verspäteten Kolo-
nisierung mit diesen Mikroben, denen güns-
tige Eigenschaften zugeschriebenwerden. [9]
Eine deutliche Zunahme an Bi dobakterien
beim Neugeborenen konnte hingegen durch
die Gabe eines Probiotikums (Lactobacillus
rhamnosus) in der späten Schwangerschaft
erreicht werden. [10] Kinder von Müttern, die
in der Schwangerschaft rauchten, haben ein
erhöhtes Risiko ein Reizdarmsyndrom zu ent-
wickeln. Dies wird unter anderem mit einer
nikotinbedingten Änderung der Mikrobi-
ota beim Neugeborenen in Zusammenhang
gebracht. [11] Auch die Schwangerschafts-
dauer dürfte einen Ein uss auf die mikrobi-
elle Besiedelung beim Neugeborenen haben.
Es konnte gezeigt werden, dass diese bei
Frühgeborenen langsamer abläuft und eine
geringere Diversität als bei Reifgeborenen
aufweist. Zusätzlich führen auch eine ver-
zögerte enterale Ernährung, die aseptische
Umgebung sowie häu ge Antibiotika-Gaben
zu einer verzögerten oder gestörten bakteri-
ellen Besiedelung bei Frühgeborenen. Verän-
derte Diversität, Unreife des Immunsystems
und eine instabile Darmbarriere begünstigen
die Invasion von pathogenen Keimen, wes-
halb eine anormale Mikrobiota unter ande-
rem mit dem Auftreten einer Neugebore-
nensepsis und gastrointestinalen Störungen,
einschließlich einer Nekrotisierenden Ente-
rokolitis (NEC), in Zusammenhang gebracht
wird. [12]
Die Beobachtung, dass die Anzahl an Prote-
obakterien im Zeitraum von 1 bis 2 Wochen
vor dem Auftreten einer NEC bzw. einer Late-
onset Sepsis im Vergleich zu gesunden Kon-
trollen erniedrigt ist, erö net ein Fenster für
mögliche therapeutische Intervention. [13]
Peri- bzw. postnatale Ein üsse auf die
Darmmikrobiota
Während und unmittelbar nach der Geburt
wird der Organismus des Kindes mit Mikro-
ben vonMutter und Umwelt konfrontiert und
ein neues komplexes mikrobielles Ökosystem
beginnt sich im Darm zu entwickeln. Bereits
vier Stunden nach der Geburt können Bak-
terien im Mekonium nachgewiesen werden.
[3] Diese initiale Besiedlung des Darms des
Neugeborenen resultiert aus dem direkten
Kontakt mit umgebendenMikroben undwird
zum Dickdarm nimmt die bakterielle Besied-
lungsdichte bei steigendem pH-Wert und
entsprechend den Verdauungsfunktionen
stets zu. Im Kolon beispielsweise ndet sich
eine hohe Dichte und Diversität an Bakterien,
um unverdaute Nahrung zu fermentieren.
Mikrobielle Besiedelung des Darms –
Ein uss zahlreicher Faktoren
Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass
der Prozess der mikrobiellen Besiedelung
und die Entwicklung einer optimalen Wirt-
Mikroben-Symbiose während der frühen
Kindheit einen starken Ein uss auf physio-
logische Prozesse, Sto wechselfunktio-
nen und die Entwicklung des Immunsys-
tems haben und somit von entscheidender
Bedeutung für Gesundheit und Krankheit im
weiteren Leben sind. Neben demWirt-Geno-
typ kommt Umweltfaktoren eine wesentli-
che Bedeutung zu, was dadurch verdeutlicht
wird, dass sich die Spezies bei eineiigen Zwil-
lingen nur in 50-80 % gleichen. [6]
Pränatale Ein üsse auf die Darmmikrobiota
Lange Zeit wurde der intrauterine Bereich
samt Fetus als steril angesehen. Dieser
Ansicht widersprechen die Ergebnisse einiger
Studien, die diverse kommensale Bakterien
in Nabelschnurblut, Amnion üssigkeit, Pla-
zenta und Mekonium nachweisen konnten.
[7] Neben dieser „pränatalen Flora“, deren
genaue Bedeutung noch zu klären ist, dürften
bei der mikrobiellen Darm-Besiedelung von
Neugeborenen auch verschiedene externe
Faktoren eine Rolle spielen. So haben z.B.
Nachkommen von A enmüttern, die wäh-
















