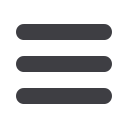
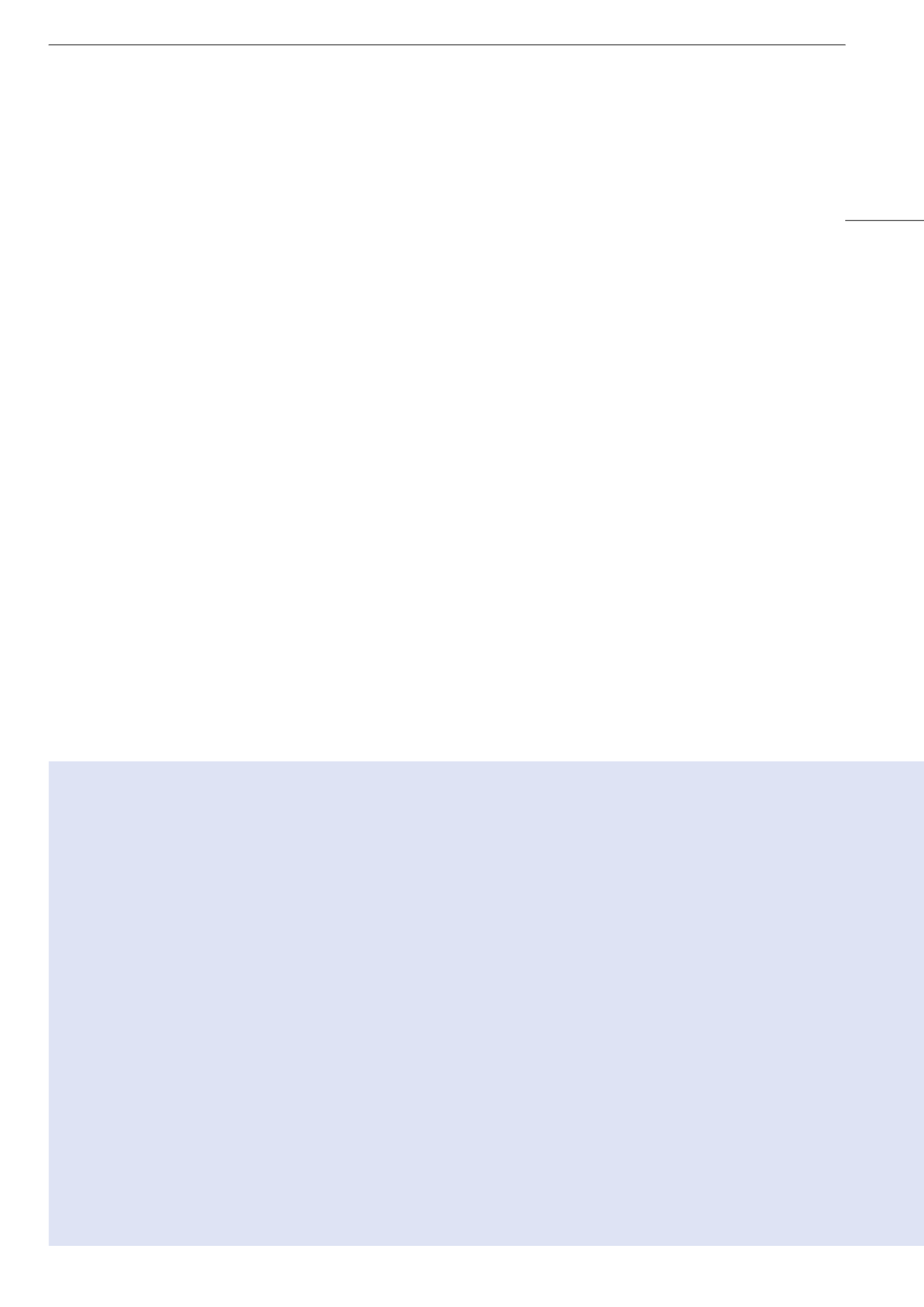
01 / 2017
FORTB I LDUNG
K I N D E R Ä R Z T E
.
SCHWEIZ
27
Abdomen-Übersichtsröntgen kann bei dieser Fragestel-
lung weiterhelfen.
Bei Kindern mit
Enkopresis
(Stuhlschmieren) wird
nicht selten eine Verhaltensstörung vermutet und ein
Kinderpsychiater beigezogen. In den meisten Fällen
handelt es sich jedoch um eine Überlauf-Enkopresis bei
chronischer Obstipation und nicht um ein psychisches
Problem. Mit Beseitigung der Obstipation bessert die
Symptomatik.
Herausforderungen in der Therapie
Die Therapie einer chronischen Obstipation ist langwie-
rig und braucht eine hohe Motivation von Kind und
Eltern. Je früher die Problematik erkannt und je kon-
sequenter therapiert wird, umso kürzer ist die Thera-
piedauer und umso besser die Prognose. Eine gute Be-
gleitung und Motivation der Familie ist essenziell, um
eine mehrmonatige medikamentöse Therapie gewähr-
leisten zu können.
Ziel der Behandlung ist eine Dekonditionierung,
das
Kind muss seine Angst überwinden und lernen, den
Stuhlgang nicht mehr zurückzuhalten. Dies wird erreicht
durch
eine
regelmässige, vollständige und schmerzlose
Defäkation
über einen längeren Zeitraum mithilfe von
Stuhlweichmachern.
Bevorzugt werden Medikamente mit guter Verträglich-
keit, wenig Nebenwirkungen und einfacher Einnahme res-
pektive Dosierung. Therapie der ersten Wahl sind Medika-
mente auf Basis von
Polyethylenglykol (PEG 3350/4000).
Sie sind
in jedem Alter sicher
und wirksamer als Lactulose,
welches in höheren Dosen Blähungen und Bauchschmer-
zen verursachen kann. Lactose (Milchzucker) ist auch bei
Säuglingen keine Therapieoption. Andere Medikamen-
te haben entweder mehr Nebenwirkungen oder wurden
wie die neuen Arzneimittel für Erwachsene (Lubiproston,
Linaclotide, Prucaloprid) bisher nicht an Kindern geprüft
und werden nicht empfohlen. Medikamente, die rektal
verabreicht werden müssen, sollten nicht längerfristig
angewendet werden, da sie retraumatisierend sind. Im
Falle von schmerzhaften Analrhagaden empfehlen wir
die lokale Anwendung von steroidhaltigen Crèmes (z.B.
Scheriproct
®
) in Zyklen von je 5 Tagen mit 2 Tagen Pause
zur Vermeidung von Hautatrophien.
■
QUELLEN
[1] Benninga MA et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders:
Neonate/Toddler. Gastroenterology 2016;150:1443–1455
[2] Tabbers MM et al. Evaluation and Treatment of Functional Constipa-
tion in Infants and Children: Evidence-based recommendations from
ESPGHAN and NASPGHAN. JPGN 2014;58:258–274
KORRESPONDENZADRESSE
jeannine.zeindler@triemli.zuerich.ch• Vorgehen nach folgendem Prinzip:
Darm leeren
(Desimpaktion)
mit hochdosierten PEG-Präparaten (1–1,5 g/kg/d) oder Einläufen
(2. Wahl) über 3 bis 6 Tage und
leer halten
(Erhaltungstherapie)
mit PEG-Präparaten (0,2–0,8 g/kg/d) oder Lactulose (1–2 g/kg/d).
Falls mehr als 2 Tage intensiv abgeführt wird, sollte das Kind
nachkontrolliert werden (cave: Wasser- und Elektrolytver-
lust).
• Bei weniger schweren Fällen kann direkt mit einer Erhaltungs-
therapie begonnen werden, dabei gibt der Arzt die Anfangsdo-
sierung vor (z. B. 2 TL Macrogol 4000 Pulver pro Tag). Im Verlauf
sollen die Eltern die
Dosis nach gewünschter Wirkung anpassen
(Ziel: Stuhlgang regelmässig, vollständig, schmerzlos). Das Fest-
legen einer individuellen Obergrenze in der Tagesdosis ist sinn-
voll. Oft wirkt das Medikament nicht, weil es zu tief dosiert wird,
keine Dosisanpassung stattfindet oder der Darm nie richtig ent-
leert wurde.
• Wichtig für eine gute Compliance ist der
Geschmack des Prä-
parates!
Für eine mehrmonatige Therapie eignet sich das ge-
schmacklose Macrogol 4000 Pulver, welches zudem einfach do-
siert werden kann.
•
Verabreichung:
Am besten wird das Medikament auf 1 bis 3 Do-
sen aufgeteilt, in wenig Flüssigkeit (frei wählbar) eingenommen
und innert weniger Minuten getrunken.
• Die
Erhaltungstherapie
soll
mindestens 2 Monate
fortgeführt
werden und eine
langsame Reduktion über Wochen
soll erst er-
folgen, wenn das Kind in diesem Zeitrahmen komplett asymp-
tomatisch war. Absetzversuche während der Sauberkeitserzie-
hung sind nicht empfohlen. Es gibt keine Obergrenze in der
Therapiedauer, sofern das Kind regelmässig nachkontrolliert
wird. In der Regel muss mit einer 6- bis 12-monatigen Therapie
gerechnet werden, es gibt aber auch deutlich längere Verläufe.
• Nicht-medikamentöse Massnahmen: Es soll eine
normale Flüs-
sigkeitszufuhr, Kost und körperliche Aktivität
empfohlen wer-
den. Ein entspanntes
postprandiales WC-Training
über 5 bis 10
Minuten zur Förderung des gastrokolischen Reflexes kann bei
bereits kontinenten Kindern hilfreich sein. Eine forcierte Sauber-
keitserziehung ist kontraproduktiv, das Kind darf diesbezüglich
das Tempo bestimmen.
• Für den Einsatz von
Komplementärmedizin, therapeutischen
Milchen
und
Prä- und Probiotika
gibt es bis jetzt keine Evidenz,
sie werden daher zur Therapie der funktionellen Obstipation
nicht empfohlen.
•
Rezidive sind häufig
(Ferien, Betreuungswechsel u. a.), bei Ab-
schluss der Behandlung sollten Eltern über dieses Risiko infor-
miert werden, damit sie im Falle eines Rezidivs eine frühzeitige
Therapie einleiten können.
Folgende Punkte sind bei der Verordnung der Therapie und Patienteninstruktion wichtig:
















