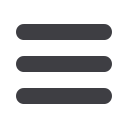
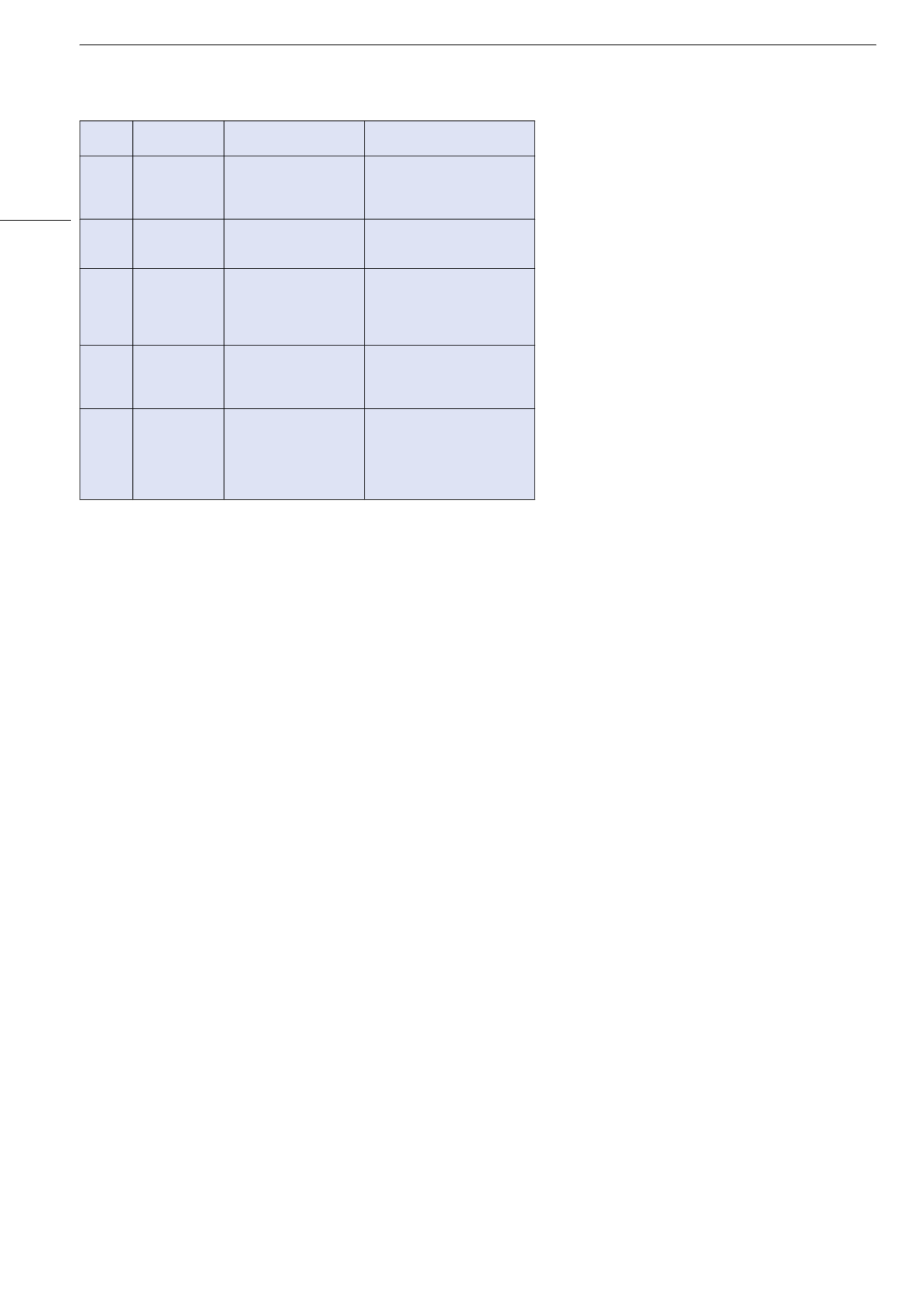
FORTB I LDUNG
01 / 2017
K I N D E R Ä R Z T E
.
SCHWEIZ
22
bleme der Oromotorik, Infantile Anorexie (immer mit
Gewichtsverlust), posttraumatische Fütterstörungen so-
wie Essverweigerung als Ausdruck einer emotionalen
Störung. (Eine vollständige Auflistung der klinischen
Essstörungen der frühen Kindheit siehe
Tabelle 2)
.
Hinweise für Interventionsbedarf:
Untergewicht
verlangt ohnehin zunächst eine Ab
klärung eventueller körperlicher Ursachen der Gedeih
störung. Idealerweise findet parallel dazu bereits eine
psychologische Begleitung der Familie statt.
Anamnese
Berichtete Auffälligkeiten im Essverhalten, die auch bei
normalgewichtigen Kindern auf frühkindliche Essstö-
rungen hinweisen können:
– Kind zeigt keine eindeutigen Signale für «Hunger», isst
nur kleine Mengen und hat kein Interesse am Essen
– Kind reagiert negativ auf neue Nahrungsmittel,
würgt, erbricht
– Kind kann keine altersadäquaten Konsistenzen verar-
beiten (kaut z. B. noch nicht mit 20 Monaten)
– Kind wird im Schlaf mit der Flasche ernährt
– Kind braucht zum Essen immer mehr Ablenkung
– Kind verweigert das «Gefüttertwerden», akzeptiert
aber sofort Fingerfood
– Starke Kontrolle der Eltern bei Mahlzeiten
– Dauer der Mahlzeiten >45 min/Mahlzeit
– Dauer der Beschäftigung mit Essen >5 h/Tag
– Eltern haben selbst aufgehört, mit Kind zu essen
– Die Probleme ums Essen dominieren den Familien
alltag und verhindern andere Aktivitäten
– Die Eltern berichten, sie hätten schon «alles probiert»
und profitieren nicht mehr von Ratschlägen
Beobachtung
Den grössten Aufschluss über die Problematik bekommt
man, wenn man das Kind direkt beim Essen beobachten
kann. Die Eltern können ein Video von einer Esssituation
erstellen und mitbringen. Noch aufschlussreicher ist es,
gemeinsam mit der Familie zu essen. Statt über das Kind
zu sprechen, kann sein Essverhalten und das seiner Eltern
direkt beobachtet werden. Das Kind kann sich in all sei-
nen Facetten zeigen, wir bekommen einen Eindruck von
Motorik, Sensorik, vom Entwicklungsstand, Kommunika-
tionsverhalten und vom szenischen Gestalten der Esssitu-
ation innerhalb der Familie. Darüber hinaus ergeben sich
bereits zahlreiche Möglichkeiten für Mikrointerventionen.
Fallbeispiel
Ich treffe den 14 Monate alten Mathis und seine El-
tern zu einem ersten Termin im Restaurant des Kinder-
spitals. Auf dem Weg von der Poliklinik zum Restaurant
hatte er mit verhaltener Neugier intensiven Blickkon-
takt zu mir aufgenommen. Mathis wirkt altersentspre-
chend entwickelt, aufgeweckt und fröhlich. Auf die vie-
len Reize im Restaurant reagiert er mit Interesse und
lässt sich auf ein kleines Spiel ein, während wir den Platz
an einem Tisch vorbereiten. Die Eltern wirken sehr an-
gespannt, äussern, wie froh sie sind, dass sie kommen
durften. Sie hätten das Gefühl, dass niemand sie ernst
nehme. Sowohl die Mütterberaterin als auch der Kinder-
arzt sagten immer, das Kind sei normal entwickelt und
«sehe doch gut aus». Niemand könne jedoch ermessen,
welch grosse Probleme und Sorgen sie zu Hause hätten:
Mathis werde immer noch hauptsächlich von Mutter-
milch ernährt. Diese verlange er mit grossem Nachdruck,
vor allem auch nachts (bis zu 7 Mal). Jegliche Versuche
mit halbfester und fester Nahrung seien gescheitert. Ne-
ben der Muttermilch von der Brust akzeptiere Mathis nur
Wasser aus der Trinkflasche sowie eine bestimmte Quark-
sorte (Himbeerquark von der Migros), die man ihm geben
könne, während er einen Film auf dem iPad schaue. So-
bald andere Nahrung sich ihm annähere, würge oder er-
breche er. Die Eltern sind überrascht von meiner einzigen
Anweisung (alle Erwachsenen essen), lassen sich schliess-
lich darauf ein, für sich etwas zu essen zu holen. Im Ver-
lauf des gemeinsamen Mittagessens verfolgt Mathis neu-
gierig das Geschehen, lässt sich auf kleine Spiele mit dem
von mir mitgebrachten Kindergeschirr und kleinen Men-
gen Esswaren ein. Er beginnt, Nahrungsmittel vorsichtig
mit den Fingern zu explorieren. Sobald ein Elternteil ver-
sucht, Mathis etwas einzugeben oder ihm etwas zu essen
anbietet, reagiert das Kind mit heftiger Abwehr, Weinen
und Wegdrehen. Beim Anblick des Löffels fängt er an zu
würgen. Als ich die Eltern bitte, jegliche Fütterversuche
und Angebote für eine Weile zu unterlassen, schaut mich
Mathis mit grossen Augen intensiv an. Die Eltern konzen
trieren sich nun darauf, mir ihre grosse Not zu schildern,
den Druck in der Grossfamilie, ihr Gefühl, die einzigen
zu sein, die nicht mal ihr Kind zum Essen bringen kön-
nen. Sie wundern sich, dass Mathis bisher noch nicht er-
brochen hat, was er sonst während Mahlzeiten meist tut.
Mathis hat sich inzwischen mit dem Zerkleinern von Pom-
Alter/
Monate
Entwicklungs-
thema
In Bezug aufs Essen
Anforderung an Beziehung
Pränatal
Körperliche Einheit
mit Mutter
Ernährt werden über Nabel-
schnur; Partizipation an von
Mutter bereitgestellten Sinnes-
eindrücken
Kind: orale Selbststimulation
Eltern: Ausrichtung auf Elternrolle,
das fantasierte Kind
0–4
Symbiose;
basale Zustands
regulation
Saugen lernen (Kraft, Koor-
dination); Hunger erkennen,
Hunger und Sattheit regulieren
Kind: Hunger/Sattheit signalisieren
Eltern: Signale richtig deuten und
adäquat reagieren
4–6
Welt der Objekte
entdecken
Orale und taktile Exploration;
Übergang zum Löffel 1 und
erste Beikost
Kind: Aufmerksamkeit auf Essen
fokussieren
Eltern/Beziehung: Erste Konflikte von
Nähe und Distanz müssen bewältigt
werden
6–12 Bindung – Tren-
nung; beginnende
Individuation
Übergang zum Löffel 2; selbst-
ständigeres Essen, Koordi
nation zwischen Hand- und
Mundmotorik
Kind: Kooperation
Eltern: Feinfühligkeit
Konflikt: Abhängigkeit versus Auto-
nomie
12–30 Individuation,
Autonomie,
Objektpermanenz,
Mentalisierung
Essen vom Tisch;
Das Kind wird in die grössere
(Tisch-)Gesellschaft eingeführt.
Kind: den eigenen Willen erkennen
und mit dem der anderen in Einklang
bringen; Ängste bewältigen; Kompro-
misse eingehen lernen, verhandeln
Eltern: Regeln und Esskultur der
Familie entwickeln
Tabelle 1: Entwick-
lungsaspekte und
Essen.
(Die Monatsangaben
entsprechen Durch-
schnittswerten und
können stark variieren).
















