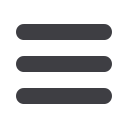

K I N D E R Ä R Z T E
.
SCHWEIZ
15
FORTB I LDUNG
1-Nahrung hat es neben Laktose wenig Stärke und Maltodextrin.
Folgenahrungen (Typ 2,3):
sind Säuglingsmilchen, die für die be-
sondere Ernährung von gesunden Säuglingen bestimmt sind ab Ein-
führung einer angemessenen Beikost bzw. ab ca. sechs Monaten.
Sie stellen den grössten flüssigen Anteil einer nach und nach ab-
wechslungsreicheren Kost dieser Säuglinge dar. Folgenahrungen
können auch nach dem ersten Lebensjahr gefüttert werden.
Beachte:
Säuglingsanfangsnahrungen können aber auch nach
Beginn der Beikosteinführung bis zum Ende des 1. Lebensjahres
weitergefüttert werden. Folgenahrungen sollen erst angeboten
werden, wenn der Säugling bereits Beikost bekommt.
Unterschied Anfangs- und Folgenahrungen:
Biologisch lässt sich die Unterscheidung von Säuglingsanfangs- und
Folgenahrung nicht begründen. Muttermilch verändert sich zwar im
Laufe der Laktationsperiode (so fällt z.B. der Proteingehalt), aber eine
wesentliche Änderung nach 4–6 Monaten tritt nicht auf, welche den
Einsatz von Folgenahrungen als Produkt rechtfertigen. Folgenahrun-
gen (2- und 3-Nahrung) enthalten mehr Kohlenhydrate (Laktose und
Stärke), einen etwas höheren Eiweissgehalt und mehr Vitamine und
Mineralstoffe als Anfangsnahrung. Der Grund für die Unterscheidung
dieser Säuglingsnahrungen sind die Möglichkeiten der Werbung und
Vermarktung und weniger eine physiologische Notwendigkeit.
Was steckt hinter den verschiedenen von der Industrie
angepriesenen Säuglingsmilchen:
Pre- und Probiotika:
Die Zusammensetzung der Darmflora von gestill-
ten und nichtgestillten Säuglingen unterscheidet sich deutlich: Ge-
stillte Kinder haben mehrheitlich Bifidusbakterien und Laktobazillen
im Stuhl, während nichtgestillte eine Mischflora aufweisen. Detaillier-
te Untersuchungen der Kohlenhydrate der Muttermilch haben erge-
ben, dass in der Muttermilch neben dem Hauptkohlenhydrat Lakto-
se noch ca. 1%Oligosaccharide enthalten sind. Es handelt sich dabei
um galaktosehaltige kurzkettige Kohlenhydrate, die als Galakto-Oli-
gosaccharide (GOS) bezeichnet werden. Es gibt Hinweise, dass diese
Oligosaccharide eine wichtige Rolle bei der Bildung der Darmflora
spielen bzw. bifidogen wirken und daher prebiotisch aktiv sind. Für
die Gesundheit des Säuglings wird die Entwicklung einer prädomi-
nanten Bifidusflora als wichtig erachtet, da sie sowohl die gramposi-
tiven als auch gramnegativen pathogenen Bakterien inhibiert und ei-
nen immunstimulierenden Effekt hat. Um sich den oben erwähnten
Vorteilen der Muttermilch anzunähern, werden von verschiedenen
Herstellern die Säuglingsmilchen entweder mit prebiotisch aktiven
Oligosacchariden oder direkt probiotischen Bakterien (Bifidobakte-
rien, Laktobazillen) angereichert. Die Zusätze in den auf dem Markt
befindlichen Säuglingsnahrungen gelten für gesunde Säuglinge als
sicher; ein klinisch relevanter Nutzen hingegen ist unklar [7].
Omega-Fettsäuren:
Langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäu-
ren, Omega-3, Omega-6 (LC-PUFA): LC-PUFA sind von zentraler
Bedeutung für die Entwicklung und Funktion des Gehirns sowie
des Nervensystems. Eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-
und Omega-6-Fettsäuren (DHA, EPA, AA) ist daher für die norma-
le Entwicklung während des fetalen Wachstums und für die visu-
ellen und kognitiven Funktionen bei Neugeborenen unentbehrlich.
Muttermilch enthält, im Gegensatz zu Kuhmilch, langkettige mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren (LC-PUFA). Die Zugabe von LC-PUFA
wie Docosahexaensäure (DHA) zu Säuglingsnahrungen scheint sich
günstig auf die Reifung des kindlichen Sehvermögens und hinsicht-
lich der kindlichen Entwicklung auszuwirken [2].
Kuhmilch – wieso ungeeignet im 1. Lebensjahr
Säuglinge, die mit reiner Kuhmilch ernährt werden, erhalten eine
inadäquate Versorgung mit Eisen, essenziellen Fettsäuren und Vi-
tamin E und eine zu hohe Zufuhr an Protein, Natrium und Kali-
um. Während Muttermilch bzw. Säuglingsnahrung ca.15 / 30 mg
Na/100 ml enthalten, liegt der Na-Gehalt der Kuhmilch bei 55 mg
Na/100 ml. Wird der Säugling anstelle von Muttermilch/Säuglings-
nahrung mit Kuhmilch ernährt, besteht eine erhebliche Na-Überla-
dung. Dies führt im Zusammenhang mit der noch nicht vollständig
entwickelten Ausscheidungsfunktion der Säuglingsniere zu einer er-
höhten Wasserausscheidung, da durch die osmotisch wirksame Na-
Ausscheidung freies Wasser verloren geht [8]. In Situationen mit ver-
minderter Flüssigkeitszufuhr, Erbrechen oder Diarrhoe bedeutet dies
für den Säugling ein Dehydratationsrisiko, da durch die Kuhmilch zu
wenig freies Wasser geliefert wird. Beim gesunden Säugling scheint
eine leicht höhere renale Belastung kaum nachteilige Folgen zu ha-
ben. Kleinere Mengen an Kuhmilch können daher bedenkenlos ab
dem 6.–7. Lebensmonat bei der Zubereitung der Beikost verwen-
det werden. Ab dem 2. Lebensjahr kann die Säuglingsanfangs- oder
Folgenahrung durch Kuhmilch (Vollmilch) ersetzt werden.
Kommentar:
Der Hauptgrund für eine restriktive Einführung von
Kuhmilch ist die Vermeidung eines Eisenmangels, da Kuhmilch eisen
arm ist. Zudem weisen einige Studien darauf hin, dass das frühe
Einführen von Kuhmilch beim jungen Säugling mikroskopische in-
testinale Blutungen hervorrufen kann. Als Getränk sollte Kuhmilch
daher erst ab dem 2. Lebensjahr gegeben werden, wenn das
Kind aus der Tasse trinken kann. Vollmilch (3,5% Fett) eignet sich
aber bereits nach Einführung der Beikost als Bestandteil des Milch-
Getreide-Breis zur Protein- und Mineralstoffversorgung [9].
Allergieprävention
Betreffend der Allergieprävention wird auf die gemeinsamen Emp-
fehlungen der SGP, SGE (Schweiz. Gesellschaft für Ernährung) und
EEK (Eidg. Ernährungskomission) 2017 hingewiesen, welche dem-
nächst publiziert werden.
Einführung Beikost
Zeitpunkt Beikosteinführung
Die Einführung der Beikost ist ein wichtiger Schritt bei der Transition
von der ausschliesslichen Milchnahrung zur Familienkost. Vorausset-
zung zur Toleranz der Beikost ist der physiologische Reifungsprozess
der Niere, des Gastrointestinaltraktes und neurologischen Funktionen.
Die Beikost sollte nicht vor dem Alter von 17 Wochen (Beginn 5. Le-
bensmonat) und nicht später als mit 26 Wochen (Beginn 7. Lebens-
monat) eingeführt werden. Der Zeitpunkt der Einführung der Beikost
bzw. die Umstellung von flüssiger auf feste Nahrung zwischen dem
5. und 6. Monat ist allerdings vom Entwicklungsgrad des Kindes ab-
hängig, welcher sehr variabel ist. Beikost sollte mit dem Löffel ange-
boten werden und nicht aus der Flasche oder dem Becher getrunken
werden.
















